
Die Sprechchöre klingen mir noch in den Ohren. Ob montags auf der Straße, als Transparent, in den Kommentarspalten auf Facebook oder in Zuschriften: Vor diesen vier Silben gab es für Journalisten in Sachsen in den vergangenen zwei Jahren kaum ein Entrinnen. Eigentlich sollte dieser Text mal heißen "Zwei Jahre 'Lügenpresse': Was haben wir erlebt?" Aber das wäre vielleicht etwas zu kurz gesprungen gewesen. Denn wir sind längst aus dem Akutmodus raus. Pegida demonstriert zwar noch, aber die Teilnehmerzahl stagniert. Das mediale Interesse hat stark nachgelassen. Nun ist also Zeit nachzudenken: über den eigenen Berufsstand, die eigene Arbeit und das Leben mit den Verunglimpfungen.
Von Nadine Lindner (Hinweis: Dieser Text ist zuerst in FUNKTURM Nr. 3 erschienen.)
Selten sind Journalisten so radikal kritisiert worden wie in Sachsen in den vergangenen zwei Jahren – mit teils justiziablen Äußerungen, in den schlimmsten Fällen auch mit körperlicher Gewalt. Die Arbeitsweisen in Rundfunk oder Zeitung oder als Lokalreporter oder überregionaler Korrespondent mögen unterschiedlich sein. Aber die Fragen, die uns noch immer bewegen, sind ähnlich: Woher kommt dieser Hass? Haben wir Fehler gemacht? Und wie können wir die in Frage gestellte Glaubwürdigkeit zurückgewinnen? Das sagen nachdenkliche, aber keineswegs entmutigte Kollegen aus Sachsen.
Die Lokalreporter
Kaum irgendwo sonst ist die Bindung zwischen Journalisten und Lesern so eng wie im Lokalen – zumal in kleinen Städten, wo oft nur eine Handvoll Reporter das Stadtleben abbildet. Was heißt es für die Arbeit, wenn der eigene Ort schlagartig in die bundesweiten Schlagzeilen gerät?
Bautzen
Wer als Lokaljournalist Fehler macht, bekommt das rasch zu spüren, sagt Ulli Schönbach, Leiter der Lokalredaktion Bautzen der Sächsischen Zeitung: "Unsere Leser sparen nicht mit Kritik, wenn ihnen etwas missfällt." Harte Reaktionen seien also nichts Neues. Aber trotzdem habe sich etwas verändert, so Schönbach, vor allem bei der Berichterstattung über Asylpolitik, Rechtsextremismus oder die Sicherheitslage: "Die Leser misstrauen nicht nur unserer Einschätzung als Journalisten, sondern auch allen Quellen, auf die wir uns berufen, etwa Behörden, Polizei und Justiz."
"Du weißt schon vorher, bei welchen Themen und Reizwörtern die Wellen hochschlagen." Ulli Schönbach
Außerdem beobachte er eine Verrohung des Tons, sagt Schönbach, der die Redaktion in Bautzen seit zwölf Jahren leitet. "Noch vor zwei oder drei Jahren war es möglich, über die Facebook-Seite unserer Redaktion sachliche Debatten auch zu kontroversen Themen der Lokalpolitik zu führen, etwa zum Bau eines neuen Einkaufszentrums. Diese Zeiten sind vorbei."
Als Antworte helfe da nur Professionalität – und eine gewisse Tiefenschärfe. "Wo wir früher schlicht von einer rechtsextremen Demo gesprochen hätten, unterstreichen wir diese Einschätzung heute durch zusätzliche Fakten – etwa mitgeführte Banner, Parolen oder den politischen Hintergrund bestimmter Redner."
Ob man in einem solchen Umfeld die Liebe zum Beruf verliert? "Das sicher nicht. Aber die Leichtigkeit fehlt. Du weißt schon vorher, bei welchen Themen und Reizwörtern die Wellen hochschlagen. Diesen ganzen Stumpfsinn hast du beim Schreiben im Hinterkopf. Das nervt."
Wenn die eigene Stadt auf einmal in den bundesweiten Fokus gerät, dann entstehe ein problematisches Wechselspiel, bei dem das Publikum auf die massive Berichterstattung mit einer pauschalen Abwehrhaltung reagiere, findet der 41-Jährige. Nicht die rechtsextreme Szene stehe im Mittelpunkt, sondern die Selbstwahrnehmung der Stadt als Opfer des Medienbetriebs.
Auf der anderen Seite verstärke die oberflächliche Arbeit von Journalisten, denen es an Orts- oder Sachkenntnis fehle, diese Abwehrhaltung. "So wird zum Beispiel das Bild des brennenden Husarenhofes in Bautzen immer wieder als Symbolbild für rechte Straftaten eingesetzt, obwohl der Anschlag bislang nicht aufgeklärt ist."
Chemnitz-Einsiedel
"Am Anfang, 2014, hat es mich gar nicht so überrascht, dass neben der Politik auch die Medien zur Zielscheibe des Protests wurden. Wir Journalisten galten als Teil des Systems, weil wir in den Augen der Kritiker nichts gegen die empfundene Misere unternommen hatten", erinnert sich Michael Müller, der seit Ende 2010 für die Chemnitzer Lokalredaktion der Freien Presse unter anderem über Stadtentwicklung, Verkehr und Gerichtsprozesse berichtet.
"Auch ein Teil der Anwohnerschaft, den ich als sehr vernünftig und gut gebildet erlebt habe, hat mir gesagt: 'Gefühle lassen sich nicht vorschreiben.'" Michael Müller
Mittlerweile werde das Wort "Lügenpresse" aber ganz bewusst eingesetzt, um Misstrauen gegenüber den Medien zu säen. Müller hat sich intensiv mit den Protesten gegen die Unterbringung von Asylbewerbern in Chemnitz-Einsiedel beschäftigt. Schon nach kurzer Zeit sei es für ihn relativ schwierig gewesen, dort zu arbeiten. Warum? Weil er für den schlechten Ruf des Stadtteils mitverantwortlich gemacht wurde.
Auch jetzt, wo die Unterkunft geräumt und die Proteste abgeflaut seien, würden viele Anwohner den Medienvertretern nach wie vor mehr als skeptisch gegenüberstehen: "Auch ein Teil der Anwohnerschaft, den ich als sehr vernünftig und gut gebildet erlebt habe, hat mir gesagt: 'Gefühle lassen sich nicht vorschreiben.' Damit wollten sie sagen: Egal, ob was passiert ist oder nicht, sie hätten kein gutes Gefühl dabei, dass Flüchtlinge hier untergebracht werden." Und da, sagt Michael Müller, sei ihm noch mal klargeworden, dass es Grenzen für rationale Argumente gebe.
Das Fazit des Lokalreporters aus Chemnitz: "Wir dürfen den Lügenpresse-Rufern kein Futter geben. Wir müssen zeigen, dass wir die Themen, die die Menschen beschäftigen, ernst nehmen. So haben wir Polizeistatistiken auseinandergenommen, in denen es um Kriminalität von Asylbewerbern ging. Oder wir haben umstrittene Gerichtsurteile erklärt."
Die Freie Presse nenne inzwischen häufig die Herkunft von Straftätern. Das werde von den Kritikern zur Kenntnis genommen, wobei die dann zuweilen fragten, "warum es nicht schon in der Überschrift stehe, dann müsse man nicht den ganzen Artikel lesen." Auch das Thema Sicherheit in der Innenstadt, das viele Chemnitzer umtreibe, werde ausführlich bearbeitet. Müller glaubt, dass dies bei dem gemäßigteren Teil der Medienkritiker verfange. Denen könne man zeigen, "dass die Zeitung bestimmte Dinge eben nicht unter den Teppich kehrt." Man dürfe sich aber nicht anbiedern.
Freital
"Man darf keine Angst vor der Reaktion der Leser haben, sondern muss einfach seinen Job machen: Sagen, was ist." Nicht verharmlosen, nicht überziehen. Dieses Fazit zieht Andrea Schawe nach ihrer Zeit als Lokalredakteurin für die Sächsische Zeitung in Freital, wo sie ein gutes Jahr gearbeitet hat, bevor sie in die Politikredaktion der SZ nach Dresden wechselte.
Zweimal stand Freital zuletzt im Fokus der bundesweiten Berichterstattung. Viele Freitaler – auch aus dem Rathaus – hätten es als ungerecht empfunden, dass jeweils so viel über ihre Stadt geschrieben wurde. "Den Vorwurf habe ich oft gehört: Die Medien seien schuld am schlechten Image der Stadt, nicht diejenigen, die Asylbewerber und Andersdenkende angreifen. Wenn wir aufhören würden zu berichten, sei das Problem gelöst."
"Man darf keine Angst vor der Reaktion der Leser haben, sondern muss einfach seinen Job machen: Sagen, was ist." Andrea Schawe
Aber, sagt Schawe, das Problem, das Freital mit Rechtsterrorismus habe, würden sich die Journalisten ja nicht an ihrem Schreibtisch ausdenken. Sie finde es gut, Gerüchten mit Fakten zu begegnen, "aber es gab eine Zeit, da sind wir jeden Tag Gerüchten über angebliche Ladendiebstähle oder Vergewaltigungen nachgegangen, die einfach nicht stattgefunden haben". Das sei auf Dauer nicht zu leisten.
Auch ist sie skeptisch: Nicht jeder Kritiker könne mit guter journalistischer Arbeit zurückgewonnen werden.
"Manche sind verloren im Universum aus Verschwörungstheorien, Compact-Magazin, pi-news und russischer Propaganda." Und doch dürfe man dieser Abwehrhaltung nicht nachgeben: "Ich finde, es schadet nicht, den Zweiflern jedes Mal wieder zu erklären, dass es keine Vorgaben gibt. Dass ich wirklich schreiben kann, was ich denke, ohne meinen Job zu verlieren."
"Wir können diejenigen erreichen, bei denen sich leichte Zweifel breitgemacht haben." Heinrich Maria Löbbers
Heinrich Maria Löbbers, Mitglied der SZ-Chefredaktion ergänzt: "Wir können diejenigen erreichen, bei denen sich leichte Zweifel breitgemacht haben. Zum Beispiel, indem wir in unserer wöchentlichen Kolumne erklären, wie Zeitung funktioniert und warum wir welche Themen wie aufgreifen." Transparenz sei entscheidend.
Auch deshalb hat sich die Sächsische Zeitung zum 1. Juli 2016 entschieden, konsequent die Herkunft von Straftätern zu nennen. Die Erfahrungen damit seien gut: "Es gab ein großes, auch kontroverses Medienecho. Unsere Leser haben das erst mal eher unaufgeregt zur Kenntnis genommen. Es ist ein wenig Aufwand, noch mal bei der Polizei nachzufragen, aber inzwischen Normalität."

Leipzig
"Am Anfang war ich völlig perplex, dass ich beim Arbeiten angegriffen werde. Nur weil ich sehen will, was in meiner Stadt vor sich geht." Merten W. schüttelt immer noch den Kopf, wenn er an den Januar 2015 denkt. Zusammen mit anderen Leipziger Journalisten wurde der 25-jährige Student, der für das Uni-Radio mephisto 97.6 arbeitet, damals während einer Legida-Demonstration von einem Mob gejagt. Merten ließ das Mikro mitlaufen und konnte der Polizei so den entscheidenden Hinweis liefern.
Die Folge: Droh-Anrufe und Hass-Mails, weshalb er bis heute unter dem Synonym Merten W. arbeitet. Trotzdem liebt
er seinen Beruf und will weiterhin als Journalist tätig sein, auch wenn er schon manchmal gefragt werde, ob das so klug sei.
Merten, der nach seinem Bachelor in Germanistik für mephisto, das Leipziger Internet-Radio detektor.fm und den MDR arbeitet, hat beobachtet, dass einige seiner Kollegen inzwischen manchmal lieber die Finger von heiklen Themen lassen. Aus Angst, dass auch kleinste Fehler ausgeschlachtet würden.
Der MDR
"Es ist ja nicht so, dass man Glaubwürdigkeit per Knopfdruck anknipsen kann und – zack – ist das dann geklärt." Stefan Raue
Der MDR ist eine wichtige Schnittstelle zwischen regionaler und bundesweiter Berichterstattung, denn die Redaktionen der ARD-Anstalt beliefern viele Formate in Hörfunk und Fernsehen.
So werden natürlich auch MDR-Journalisten als "Lügenpresse" geschmäht, der Sender dient darüber hinaus aber auch wegen der Gebühren-Finanzierung, »Zwangsgebühren« werden sie von den Kritikern genannt, als Zielscheibe.
"Es ist ja nicht so, dass man Glaubwürdigkeit per Knopfdruck anknipsen kann und – zack – ist das dann geklärt." Nein, das sei ein vielschichtiges Thema, sagt der 1. Chefredakteur des MDR Stefan Raue. Viele Kritiker glaubten, die Meinung der Intendantin oder des Chefredakteurs werde bis in die untersten Ebenen durchgereicht. Deshalb habe er darauf gedrungen, einen kritischen Blick auf die internen Diskussionsstrukturen des MDR zu werfen. "Wir leben davon, dass unterschiedliche Einschätzungen in den Redaktionen zu Wort kommen."
Wichtig sei es auch, die Arbeitsprozesse transparent darzustellen. "Wir dürfen uns nicht weiter hinter der Kulisse, quasi auf unserem Sendergelände, verstecken. Sondern wir müssen raus." Das sei vielleicht in den letzten Jahren zu kurz gekommen.
Als geglücktes Experiment sieht Raue einen Beitrag für das ARD-Morgenmagazin Ende Januar 2016 an, bei dem zwei Pegida-Demonstranten die komplette Entstehung eines TV-Beitrags begleiten konnten – und den MDR-Reporter quasi im Austausch zur Demo mitnahmen. "Was stört Sie und was würden Sie anders machen?", waren die Leitfragen der Reportage. "Ich war über das positive Echo sehr überrascht. Ob Pegida-Anhänger oder nicht: Viele, die uns im Anschluss geschrieben haben, hatten wohl keine konkreten Vorstellungen davon, wie wir eigentlich jeden Tag arbeiten, die hatten sich das viel zentralistischer vorgestellt."
Bei den Medien-Kritikern und "Lügenpresse"-Rufern wolle man sich auf die konzentrieren, die noch erreichbar seien für den Dialog. "Aber ich glaube auch, dass sich ein großer Teil förmlich eingebunkert hat." Wenn er auf andere politische Protestbewegungen der vergangenen Jahrzehnte zurückblicke, sehe er einen wichtigen Unterschied: "Ob Anti-Atom, Anti-Kernwaffen oder auch Stuttgart 21, die haben immer versucht, ihre Themen in den Medien zu vertreten."
Die Glaubwürdigkeit hat auch MDR-Intendantin Karola Wille in ihren Leitgedanken für den ARD-Vorsitz zum zentralen Thema für das Jahr 2016 erhoben. In dem Papier spricht sie die besondere Rolle ihres Hauses innerhalb der ARD an: "Gerade für den MDR gehört dazu übrigens auch eine wirklichkeitsgetreue Darstellung Ost und Mitteldeutschlands, um den Prozess der inneren Einheit Deutschlands weiter zu befördern."
Stefan Raue kennt diese Beobachtung aus dem Tagesgeschäft: "Es ist schon auch ein gewisser Aufwand, den ich betreibe, um meinen Kollegen in Köln, München oder Hamburg klarzumachen, dass es hier in Mitteldeutschland eine vielfältige politische Kultur gibt, viele Menschen, die sich engagieren, und nicht nur Pegida und merkwürdige Landtagswahlergebnisse."
"Die Schläge kamen von hinten." Ine Dippmann
Eine heftige Begegnung mit "Lügenpresse"-Rufern hatte Ine Dippmann, seit Januar 2014 landespolitische Hörfunk-Korrespondentin von MDR Aktuell, im Januar 2016 bei einer Pegida/Legida-Demo in Leipzig. "Die Schläge kamen von hinten. Der erste traf mein Handy, das flog in hohem Bogen weg. Der zweite traf mich im Gesicht."
Zugeschlagen hatte eine ältere Frau. Die Angreiferin hatte sich wohl daran gestört, dass die Reporterin mit dem Handy Fotos von Pegida-Organisator Lutz Bachmann machte. Die Täterin konnte in der Menge verschwinden, ist bis heute nicht ermittelt. Dippmann sagt, sie sei seitdem noch aufmerksamer auf Demos unterwegs und bereite sich besser vor: "Ich telefoniere im Vorfeld mit den Pressesprechern der Polizei." Außerdem geht sie nicht mehr allein.
Nach Veränderungen in ihrer alltäglichen Arbeit gefragt, sagt Dippmann, dass sie noch mehr als zuvor versuche, alle Seiten zu Wort kommen zu lassen. "Außerdem will ich nicht nur die aufregendsten Ausschnitte und extremsten Parolen eines Demo-Abends zeigen. Sondern auch die Grau-Bereiche dazwischen." An die "Lügenpresse"-Rufe habe sie sich inzwischen gewöhnt, sagt Dippmann. "Am Anfang hat mich das richtig bewegt, aber mittlerweile lächle ich es eher weg."

Die Überregionalen
Dresden für den Rest des Landes übersetzen, so fühle sich das manchmal an, sagt Cornelius Pollmer, der für die Süddeutsche Zeitung aus Sachsen und Thüringen berichtet. "Ich sage manchmal, dass ich inländischer Auslandskorrespondent bin." Das zeige sich sowohl im Wechselspiel mit der Zentralredaktion in München als auch bei den Rezipienten: In der Region gebe es vergleichsweise wenige – dafür aber enthusiastische – Leser.
" Dresden ist nicht Kabul." Cornelius Pollmer
Vielen Lesern der "Süddeutschen" ist der Osten insgesamt nach wie vor irgendwie fremd. "Die kannten Dresden bislang vor allem als Postkartenschönheit, seit Pegida finden sie es vor allem sehr eigentümlich."
Da nimmt er als Journalist eine Scharnierfunktion ein, so Pollmer, der in Dresden geboren ist. Seinem Beruf geht er nach wie vor gern nach: "Es ist eine angespannte Situation, aber eben auch eine spannende. Und man sollte bei aller Angespanntheit auch nicht die Maßstäbe verlieren. Dresden ist nicht Kabul."
Ob es in den Medien ein "Sachsen-Bashing" gebe, also ein bewusstes Schlechtschreiben des Bundeslandes? "Ja, es gibt diese 'assoziative Bereitschaft', Sachsen in einem negativen Kontext wahrzunehmen. Auf der anderen Seite liefert das Bundesland halt auch immer wieder Anlässe dafür."
Pollmers Bilanz nach zwei Jahren Leben und Arbeiten mit der "Lügenpresse" fällt nachdenklich aus: Diese Selbst-Heroisierung von Journalisten, dieser Tenor zu sagen, "ich bin so krass, dass ich das hier aushalte", das sei völlig unangebracht. Hinzu komme: "Für mich ist die Genauigkeit beim Schreiben noch wichtiger geworden. Und ich versuche noch mehr als vorher, Information und Meinung sauber zu trennen."
Auch sei es nicht klug gewesen, die heterogenen Anhänger von Pegida gleich kategorisieren zu wollen. Es habe mehr als ein halbes Jahr gedauert, bis man da klarer gesehen und sich eine gewisse – wie er es ausdrückt – "Autonomie" zurückerobert habe. Der Journalismus sei besser, weil präziser geworden: "Es klingt verrückt, aber vielleicht sind auch einige gute Sachsen angestoßen worden, durch die schwierigen Erfahrungen, die wir alle gemacht haben."
Und doch, ganz kann er das Gefühl des Aufgewühltseins nicht von sich wegschieben: "Meine erste Begegnung mit dem Wort 'Lügenpresse' war im Winter 2014/15, ich stand allein als Reporter an der Lennéstraße. Und dann marschierten fast 20.000 Leute auf mich zu, die alle 'Lügenpresse, Lügenpresse' riefen." Da habe er sich schon gefragt: "Meinen die wirklich mich?" Da müsste man schon das Gemüt einer Nizza-Sperre haben, damit einem das nicht nahegeht.
Auch nach zwei Jahren hat Cornelius Pollmer noch keine Ahnung, wie es für seine Heimatstadt weitergeht: »Es gibt noch kein neues Dresden, das kennt noch keiner, das hat noch keinen Sound. Die letzten zwei Jahre waren schmerzhaft für die Stadt. Aber es ist noch nicht klar, ob am Ende noch etwas Gutes entsteht oder nur eine Narbe bleibt."
"Der Begriff 'Lügenpresse' ist ziemlich in den täglichen Sprachgebrauch übergegangen." Bastian Brandau
"Der Begriff 'Lügenpresse' ist ziemlich in den täglichen Sprachgebrauch übergegangen. Hier in Dresden werde ich also häufiger damit konfrontiert als vorher in Köln oder Berlin. Und das auch in Situationen, in denen ich überhaupt nicht damit rechne, etwa beim Arzt", stellt Bastian Brandau fest. Er ist seit November 2015 für die Berichterstattung der Programme des Deutschlandradios aus Sachsen verantwortlich.
Alle würden den Begriff leichtfertig benutzen, ohne sich Gedanken zu machen, wo er historisch hingehöre. Viele würden es schlicht als gegeben hinnehmen, dass Journalisten staatlich gesteuert seien und die Aufgabe hätten, die Menschen zu manipulieren.
Die Autorin
Journalisten haben nicht das Gemüt von Nizza-Sperren. Sie sind nicht unbeweglich und starr und lassen alles an sich abprallen. Nach zwei Jahren der vehementen und teils auch gewalttätigen Kritik hat eigentlich jeder betroffene Journalist ein persönliches Resümee gezogen. Eigene Arbeitsweisen wurden auf den Prüfstand gestellt und justiert: Die Wahrnehmung – und auch Darstellung – von Grautönen wurde ausgebaut. Neue Formate, gerade in den lokalen Tageszeitungen, wurden ausprobiert und für tauglich befunden.
Selten haben so viele Journalisten in einer Region so intensiv über den eigenen Berufsstand und die eigene Arbeit nachgedacht wie derzeit in Sachsen. Radikale Kritik, im Wortsinne von radikal – bis an die Wurzel gehend – hat uns Reporter und Korrespondenten im Freistaat dazu gebracht, die eigenen Arbeitsweisen auf den Prüfstand zu stellen. Ein wenn auch schmerzhafter, so doch wertvoller Prozess.
Ein Fazit nach zwei Jahren
Wie wichtig journalistisches Handwerkszeug wie gründliche Recherche und präzise Formulierungen sind, hat die vergangene Zeit deutlich gezeigt. Denn nach den Gesprächen mit sächsischen Journalisten wird klar: Sie wollen weniger angreifbar, aber nicht weich werden. Sie werden sich nicht von der Reaktion der Leser einschüchtern lassen, sondern nüchtern sagen, was ist.
Dieser Text stammt aus FUNKTURM Nr. 3, das Medienmagazin für Sachsen. Das Heft umfasst 120 Seiten uns ist am 29.11.2016 erschienen. Weitere Themen, die in den Kontext #Lügenpresse passen, sind:
 Wir haben euch trotzdem lieb - Was sächsische Online-Redakteure ihren Lesern schon immer mal sagen wollten
Wir haben euch trotzdem lieb - Was sächsische Online-Redakteure ihren Lesern schon immer mal sagen wollten- Sachsenbashing - wie Onliner aus dem Westen den Freistaat sehen
- Erfahrungen aus Bürgerversammlungen - essayistische Betrachtung
- Erklären ohne Auszusprechen - das FUNKTURM-Sachsen-Tabu
Das Heft kann hier zum Preis von 11 Euro zzgl. Versand bestellt werden.
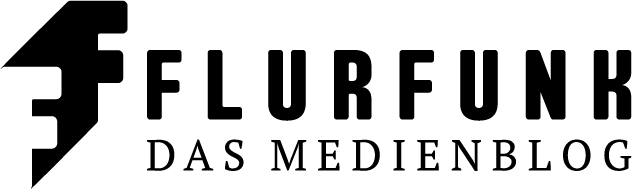
 Wir haben euch trotzdem lieb - Was sächsische Online-Redakteure ihren Lesern schon immer mal sagen wollten
Wir haben euch trotzdem lieb - Was sächsische Online-Redakteure ihren Lesern schon immer mal sagen wollten
0 Kommentare