Künstliche Intelligenz galt als Hoffnungsträger: smarter arbeiten, besser entscheiden, produktiver leben. Doch die Realität entwickelt sich anders. KI wird zum Luxusgut – und das verschärft die digitale Spaltung.
Ein Gastbeitrag von Dr. Christopher Brinkmann
 OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, sicherte sich Anfang November neue Serverpower von Amazon. Die langjährige Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) umfasst 38 Milliarden Dollar. Das war nötig, denn die Nachfrage explodiert.
OpenAI, das Unternehmen hinter ChatGPT, sicherte sich Anfang November neue Serverpower von Amazon. Die langjährige Partnerschaft mit Amazon Web Services (AWS) umfasst 38 Milliarden Dollar. Das war nötig, denn die Nachfrage explodiert.
Nach dem Start der Video-KI „Sora 2“ verzeichnete OpenAI eine Million Downloads in einer Woche. Laut Forbes kostet der Betrieb der Plattform inzwischen rund 15 Millionen Dollar pro Tag.
Die Kosten zahlen am Ende auch die Nutzer. Das Pro-Abo bei ChatGPT kostet 229 Euro im Monat. Und noch ein anderes Beispiel: Canva verlangt für volle KI-Funktionen 110 Euro im Jahr. Damit zeigt sich: Technologie für alle wird zur Frage des Geldbeutels.
Digitale Spaltung auf dritter Ebene
Digitale Ungleichheit ist kein neues Phänomen. Fachleute sprechen schon lange vom „Digital Divide“ (Digitale Kluft). Bisher ging es dabei um den Zugang zu Geräten und Internet („First Level“) und um Medienkompetenz („Second Level“).
Jetzt kommt die dritte Ebene hinzu: der „Third Level Digital Divide“ – die gesellschaftlichen Folgen dieser Unterschiede.
Denn wer bessere Technik und smartere Tools hat, kann Informationen schneller durchsuchen, präzisere Entscheidungen treffen und effizienter arbeiten. Es entsteht eine digitale Oberklasse, die vom technologischen Fortschritt profitiert, während andere zurückbleiben.
Nicht, weil der Wille fehlt, sondern wegen mangelnder Ressourcen.
KI als Preistreiber
Wie t3n erst neulich beobachtete, treiben die steigenden Server- und Entwicklungskosten die Preise für KI-Angebote nach oben. Die erwarteten sinkenden Kosten durch Skaleneffekte treten nicht ein.
Besonders problematisch: Viele Plattformen koppeln Qualität direkt an Bezahlmodelle. Die besten Ergebnisse, präzisesten Analysen und realistischsten Bilder bekommen die, die es sich leisten können. Damit wird Technologie nicht zum Werkzeug der Chancengleichheit, sondern zum Katalysator sozialer Ungleichheit.
Die Vorstellung, KI könne eine „permanente Unterklasse“ schaffen – wie der New Yorker beobachtete – erscheint damit übertrieben. Das Gegenteil ist wahrscheinlicher: eine kleine, gut informierte digitale Elite entsteht.
Brisante Folgen
Die Folgen sind gesellschaftlich brisant. Wer keinen oder nur eingeschränkten Zugang zu digitalen Wissensressourcen und KI-Werkzeugen hat, verliert langfristig Anschluss in Bildung, Arbeit und Kommunikation.
Eine Studie der Bertelsmann Stiftung zum gesellschaftlichen Zusammenhalt zeigte bereits 2024, dass Isolation, Benachteiligungsgefühle und gering ausgeprägte Selbstwirksamkeitserfahrung zu Entfremdung und Radikalisierung führen.
Damit digitale Teilhabe ein Grundpfeiler demokratischer Gesellschaft bleibt, müssen daher drei Dinge gesichert werden: bezahlbare Zugänge, digitale Bildung und politische Aufmerksamkeit für die ungleiche Verteilung. Sonst entsteht aus dem digitalen Fortschritt eine soziale Rückwärtsbewegung.
Quellen:
- Amazon & OpenAI Kooperation: aboutamazon.com/news/aws/aws-open-ai-workloads-compute-infrastructure
- Forbes: OpenAI’s tägliche KI-Kosten: www.forbes.com/sites/phoebeliu/2025/11/09/openai-spending-ai-generated-sora-videos/
- t3n: KI wird teurer für App-Anbieter: t3n.de/news/ki-teurer-app-anbieter-kosten-1705012/
- New Yorker: Permanent Underclass durch KI?: www.newyorker.com/culture/infinite-scroll/will-ai-trap-you-in-the-permanent-underclass
- Bertelsmann Stiftung: bertelsmann-stiftung.de/de/unsere-projekte/gesellschaftlicher-zusammenhalt/projektnachrichten/gesellschaftlicher-zusammenhalt-2023
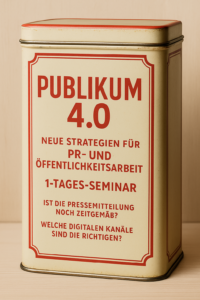 Hinweis: Treffen Sie Dr. Christopher Brinkmann als Dozent des STAWOWY-Seminars "Publikum 4.0: Neue Strategien für PR und Öffentlichkeitsarbeit" am 25.11.2025 in Dresden!
Hinweis: Treffen Sie Dr. Christopher Brinkmann als Dozent des STAWOWY-Seminars "Publikum 4.0: Neue Strategien für PR und Öffentlichkeitsarbeit" am 25.11.2025 in Dresden!
Das ist unser Tagesseminar für Kommunikationsprofis, in dem wir aufzeigen, wie sich die Öffentlichkeit verändert – und mit welchen Strategien man die eigene PR & Öffentlichkeitsarbeit zukunftssicher machen kann.
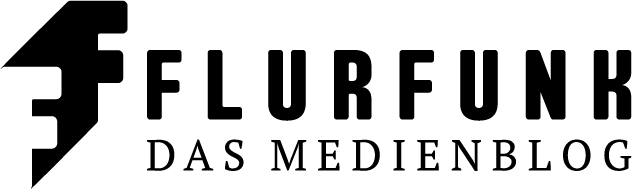
November 13, 2025
Einher geht die Entwicklung mit einer "digitalen Übergriffigkeit", die aufgrund des Datenhungers jeden Datenschutz ignoriert.
Wetter Apps, die den Zugriff auf das Adressbuch verlangen und den ständigen Zugriff auf den Standort, um anzuzeigen, wie das Wetter an irgendeinem Ort ist. Appentwickler, die auf eine Anmeldung und Registrierung bei den Betriebssystemanbietern bestehen.