Im September 2009 formulierte eine Gruppe prominenter deutscher Blogger das sogenannte Internet-Manifest. Die 17 Thesen sorgten schnell für eine lebhafte und von den Autoren gewünschte Debatte, wie Online-Journalismus sich entwickeln sollte. Sie sorgte aber auch für reichlich Kritik. Wo lag die seinerzeit teils als "Alpha-Blogger" titulierte Truppe falsch, wo trafen die Behauptungen ins Schwarze – und tun es vielleicht heute noch? Eine kritische Bestandsaufnahme.
Von Kai Heddergott

Dieser Text stammt aus FUNKTURM #9
Die Initiative war zunächst von Mario Sixtus und Thomas Knüwer ausgegangen, wurde dann aber vor allem von Sascha Lobo, Stefan Niggemeier und Markus Beckedahl ins Netz getragen.
In separaten Blogposts suchten sich die insgesamt 17 "Behauptungen" ihren Weg durchs Netz. Die Verfasserschar: alles Namen, die seinerzeit nur Fachleuten etwas sagten. Heute sind die Genannten bekannte Autoren, Berater, Aktivisten, die sich in den gesellschaftlichen Diskurs längst weithin sichtbar einbringen.
15 Unterzeichner setzten ihre digitale Paraphe unter das Manifest (unter anderem auch FLURFUNK- und FUNKTURM-Herausgeber Peter Stawowy und re:publica-Chef Johnny Haeusler).
Die mediale Resonanz war groß, denn die Manifestateure hatten mit ihren Thesen auch ein Gegenstück zur "Hamburger Erklärung" positionieren wollen. In der hatten über 160 Verleger – allen voran Hubert Burda und Springer-Chef Matthias Döpfner – in vier Punkten ihre Position in Sachen Urheberrecht und Diebstahl geistigen Eigentums klar gemacht.
Ihr Ziel: Google in die Schranken zu weisen. Denn sie sahen in der Suchmaschine und den dort in Suchergebnissen verbreiteten kostenlosen Auszügen ihres Contents ihr verlegerisches Geschäftsmodell im Netz bedroht.
Wer bestimmt den Diskurs – und welche Rolle spielt der Journalismus?
Um es vorwegzunehmen: Das Internet-Manifest setzte sich im Ergebnis nicht durch. Zu gemischt waren die Reaktionen. Insbesondere die Tonalität und die transportierte Attitüde führten zu eher kritischen Kommentaren. Allein Stefan Niggemeiers Blogpost erntete 200 Kommentare – viele nicht gerade wohlwollend.
Ein Vorwurf lautete, dass sich die geltungssüchtigen "Alpha-Blogger" lediglich publikumswirksam in Szene setzen wollten. Kritik gab es auch am Manifest selbst: Die Behauptungen seien in großen Teilen weder neu noch originell, noch seien alle Medienunternehmen so rückschrittlich wie von den Verfassern behauptet.
Die aufgeworfenen Fragen sind aber nach wie vor relevant: Wem gehört das Netz? Wer bestimmt den Diskurs – und welche Rolle spielt der Journalismus? Wie kann er sich in der sozial-digitalen Ära behaupten? Alle diesen Fragen wird nachgegangen, seit Mitte der 90er-Jahre des letzten Jahrhunderts der Online-Journalismus an die Seite von Presse, Hörfunk und Fernsehen trat.
Was sollte man also den Verlegern entgegensetzen? Hier setzte das Internet-Manifest schon in seiner ersten Behauptung "Das Internet ist anders" an: "Die Medien müssen ihre Arbeitsweise der technologischen Realität anpassen, statt sie zu ignorieren oder zu bekämpfen. Sie haben die Pflicht, auf der Basis der zur Verfügung stehenden Technik den bestmöglichen Journalismus zu entwickeln – das schließt neue journalistische Produkte mit ein."
In Behauptung Nr. 8 hieß es zudem: "Suchmaschinen und Aggregatoren fördern den Qualitätsjournalismus: Sie erhöhen langfristig die Auffindbarkeit von herausragenden Inhalten und sind so ein integraler Teil der neuen, vernetzten Öffentlichkeit."
Das Manifest also als Schnittmuster für den Journalismus und das Netz der Zukunft? Ganz so einfach lief es 2009 – wie erwähnt – nicht.
Der selbstverantwortliche Nutzer: Eine verfrühte Vision?
Das muss man sich vor Augen führen: 2009 nutzten zwar laut ARD-/ZDF-Onlinestudie bereits zwei Drittel der Deutschen ab 14 Jahren regelmäßig das Internet. Doch vom aktuellen Wert mit 90 Prozent war man noch deutlich entfernt. Die den klassischen Online-Journalismus ergänzenden Aufmerksamkeitsbeschaffer und Diskursbeschleuniger wie Facebook und Twitter standen in Deutschland eher noch am Anfang.
Online-Journalismus war für viele Nutzer auch 2009 vor allem noch das, was z.B. ihre Regionalzeitung, der SPIEGEL oder die Tagesschau online publizierten. Blogs, eigenständige Online-Magazine und neue Darstellungsformen im Netz hatten ein begrenztes Publikum. Die mobile Nutzung des Internets war noch nicht der Regelfall – wer sich online informierte, tat dies am stationären Gerät.
Das Netz war also nicht immer und überall – doch die Manifest-Autoren gingen bereits von einem aktiven, zielorientierten Nutzer aus, wie sie in der fünften Behauptung meinten feststellen zu können: "Bisher ordneten, erzwungen durch die unzulängliche Technologie, Institutionen wie Medienhäuser, Forschungsstellen oder öffentliche Einrichtungen die Informationen der Welt. Nun richtet sich jeder Bürger seine individuellen Nachrichtenfilter ein, während Suchmaschinen Informationsmengen in nie gekanntem Umfang erschließen. Der einzelne Mensch kann sich so gut informieren wie nie zuvor."
Die heutige Nutzung ist anders
Man muss kein Experte sein, um zu erkennen: Die heutige Nutzungsrealität und vor allem die Filter, die Informationen gewichten und auf Basis von Auswahlkriterien "durchlassen", führen 2018 zu einem anderen Ergebnis. Auch wenn Begriffe wie "Filterblase" abgedroschen und bisweilen sachlich unzutreffend sind: Es ist nicht der Online-Journalismus allein, der mit seinen digitalen Angeboten aktuelle Diskussionen bestimmt.
Es ist der massenhaft genutzte sozial-digitale Resonanzraum, besser bekannt als Social Media, der öffentliche Debatten maßgeblich beeinflusst.
Das ist bemerkenswert: Die Manifestateure nutzen diese Plattformen selbst seit Beginn und propagierten deren Verbreitung – sahen aber die Entwicklung von Hate-Speech und hitzigen Online-Debatten nicht voraus und ließen sich zu sehr von ihrem idealisierenden User-Bild leiten. Hier zeigt sich eine Distanz, ja sogar Diskrepanz zwischen Expertensicht und Nutzungsrealität der "normalen" User.
Das Leistungsversprechen des Internets in Zeiten von Social Media, dass jeder die vielfältigen neuen Plattformen für sich nutzen kann und selbst zur thematischen Auseinandersetzung im Wortsinne beiträgt, hat sich nur bedingt eingestellt. Die Nutzungsfrequenz hat zugenommen, ganz bestimmt war das auch von den Manifestateuren so erhofft.
In Sachen Qualität und funktionaler Wortmeldungen aber haben die Menschen mit den Füßen in eine andere Richtung abgestimmt. Es ist tatsächlich eine bedauernswert wenig am echten Dialog ausgerichtete "Debattenkultur" zu konstatieren. Meinungsbestätigende Quellen scheint es einfach zu viele zu geben, als dass man sie nicht nutzen sollte, vor allem, um das digitale Gegenüber argumentativ in die Schranken zu weisen. Ein objektiver, unabhängiger Online-Journalismus hat es da schwer, denn er interessiert viele Nutzer eher nur peripher. Und oft nur dann, wenn er argumentativ die eigene Position untermauert.
Internet-Manifest & Leistungsschutzrecht-Lobby: Der Kampf geht weiter
Die Frage, welche Rolle Suchmaschinen und digitale Plattformen im öffentlichen Diskurs spielen, ist heute so aktuell wie 2009. Die von den Verlegern angeregte Diskussion über den Schutz urheblicher Leistungen manifestierte sich 2013 in einem Leistungsschutzrecht, das 2018 von der EU-Kommission auf Basis des deutschen Vorbilds auch europaweit auf den Weg gebracht wurde. Im Dezember sprachen sich auch die EU-Innenminister für diesen Vorstoß aus (mit dem Ziel, über ein Instrument gegen Online-Propaganda von Terroristen zu verfügen).
Die Kritiker des Leistungsschutzrechtes mit seinen so genannten Uploadfiltern sehen eine erhebliche Einschränkung der Meinungsfreiheit in der EU. Denn es sollen die Plattformen und Diensteanbieter sein, die darüber entscheiden, ob ein von Nutzern bereitgestellter Inhalt gelöscht oder der Zugang gar gesperrt werden soll.
Markus Beckedahl, Initiator und Chefredakteur von netzpolitik.org und einer Unterzeichner des Internet-Manifests, sieht in der Umsetzung der Uploadfilter "eine sehr gute Zensurinfrastruktur", bei der es "keinerlei demokratische Kontrollen dafür gibt, dass sie tatsächlich für Zensurmaßnahmen zweckentfremdet werden können".
Die Diskussion ist längst also nicht mehr wie 2009 eine zuvorderst verlegerisch-ökonomische, sie ist mittlerweile eine gesellschaftlich-politische – und das in Zeiten eines gefühlt weltweiten demokratischen Backlashes. Hier liegt das Internet-Manifest nach wie vor richtig, sogar eher als zuvor: "Das Internet ist der neue Ort für den politischen Diskurs. Demokratie lebt von Beteiligung und Informationsfreiheit. Die Überführung der politischen Diskussion von den traditionellen Medien ins Internet und die Erweiterung um die aktive Beteiligung der Öffentlichkeit ist eine neue Aufgabe des Journalismus."
Das sich das online auch positiv auf verlegerische Tätigkeiten auswirken kann, zeigt beispielsweise in den USA die Zunahme von Online-Abos bei der New York Times. Angesichts täglicher Einlassungen aus dem Weißen Haus via Twitter und fortwährender Fake-News-Vorwürfen von ebenda sind Menschen bereit, für eine fundierte publizistische Gegenposition zu zahlen – auch online.
Apropos online: Wer heute das Manifest auf der eigenen Site aufrufen möchte, erhält eine Fehlermeldung. Den Wortlaut findet man aber nach wie vor auf netzpolitik.org und den Blogs von Sascha Lobo und Stefan Niggemeier. So ist das mit den Auffindbarkeiten im Netz, von dem die Manifestateure sprachen, siehe Behauptung 15: "Was im Netz ist, bleibt im Netz"...
Vive le manifest: Was zu tun ist
War also alles nur ein kleiner Sturm im digitalen Wasserglas? Die im Manifest angesprochenen Themen bleiben hochrelevant. Doch die Diskussion verblieb seinerzeit im eher elitären Expertenzirkel und wirkte sich nicht generell auf die Entwicklung des Netzes aus.
Ist das Internet-Manifest von damals also tot? Nicht ganz, der gute Kern müsste nur reanimiert werden, auf breiter Basis – und ergänzt:
- Was wir brauchen sind tatsächliche Konsequenzen, die sich aus den 2009er-Thesen und aus der Rückschau auf die seitdem zu beobachtende Entwicklung ergeben. Das ist zum einen die Vermittlung einer echten Medienkompetenz, um den autonom und kompetent handelnden User Wirklichkeit werden zu lassen. Hier sollte die Grundlage geschaffen werden für die Einschätzung, Bewertung und Identifikation von tatsächlichen und falschen Informationen über den modischen Fake-Begriff hinaus.
- Wir brauchen Leitplanken für die Ausgestaltung einer digitalen Ethik – nicht oberlehrerhaft formuliert und als Maximalfordeurng, sondern als Orientierungshilfe. Sie sollte Antworten liefern auf wichtige, zwischenzeitlich neu dazu gekommene Fragen: Wie wollen wir in der sozial-digitalen Ära das massenmedial beeinflusste gesellschaftliche Miteinander gestalten? Welche Autonomie wollen wir dabei computergestützter Aussagenproduktion via künstlicher Intelligenz (KI) einräumen?
- Die Ausformulierung der Standards des journalistischen Berufsbilds sollte schneller an die Entwicklungen angepasst werden als bislang. Es geht nicht um die Bewahrung eines Gatekeeper-Standes alter Prägung, der sich in harter Konkurrenz zu Bloggern, auf Twitter-Multiplikatoren und Instagram-Influencern abgrenzt. Vielmehr sollte der Journalismus aktuelle digitale Phänomene, Plattformen und Formate wirklich verstehen wollen und kooperativ mit den genannten anderen Akteuren die Meinungsfreiheit verteidigen. Journalismus ist zunehmend Moderation und nicht mehr allein Information und Bewertung.
So stand es schon 2009 in der Behauptung Nr. 17 "Alle für alle" – ganz am Ende des Internet-Manifests: "Nicht der besserwissende, sondern der kommunizierende und hinterfragende Journalist ist gefragt".
Hier waren die Manifestateure ihrer Zeit mit ihrem Verständnis der grundlegenden Veränderungen voraus – und genau deswegen konnten sie viele, die der Online-Journalismus heute in ihrem privaten und beruflichen Leben als wichtige Informationsquelle tangiert, nicht erreichen. Es wäre aber dringend an der Zeit, die Gedanken noch einmal aufzugreifen.
###
Hinweis 1: Auf Netzpolitik.org kann man das Manifest nachlesen: "Internet-Manifest: Wie Journalismus heute funktioniert. 17 Behauptungen." Der Beitrag dort wurde am 7.9.2009 veröffentlicht.
Hinweis 2: Der Text wurde im Dezember 2018 verfasst, noch bevor am 28. März 2019 die EU-Richtlinie zur Urheberrechtsreform inklusive Leistungsschutzrecht vom Europäischen Parlament verabschiedet wurde.

Dieser Text ist zuerst erschienen in FUNKTURM Nr. 9, ET 18.1.2019.
Weitere Themen in der aktuellen Ausgabe:
- TechKonzerne bestimmen über öffentliche Debatten? Die Politik ist gefordert!
- Fake-Profile, Verschwörungstheorien, Bullshit: Ist das Internet kaputt?
- Wie Algorithmen unser Leben beeinflussen
- Geschickt genutzt: Informationskrieg mit "anderen" Wahrheiten
- Was bringt YouTube zur Politikvermittlung?
- Geldsorgen: Die Medienbranche sucht nach neuen Geschäftsmodellen
- Liquid Democracy: Was möglich wäre, was tatsächlich geht
Heft 10 erscheint am 15.5.2019 - Thema: Wahlkampf im Social-Media-Zeitalter.
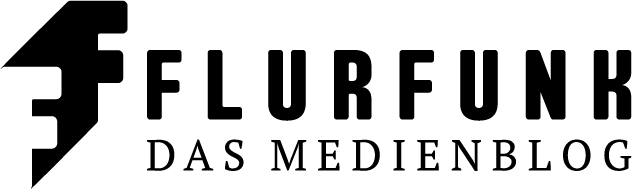
0 Kommentare