Lindner lasziv im Unterhemd oder Kretschmann verträumt in seiner Werkstatt. Weil die Parteien an Bindung verlieren, treten sie in Wahlkämpfen in den Hintergrund. Alles ist auf Personen und ihre romantisierten Geschichten zugeschnitten.
Text: Stefan Winterbauer
Hinweis: Dieser Text ist zuerst in FUNKTURM Nr. 10 im Juni 2019 erschienen.
 Wenn es um Wahlkämpfe geht, blicken wir von Deutschland aus oft mit einer Mischung aus Faszination und Abscheu in die USA. Dort – so scheint es – hat der politische Wettstreit eine ganz andere Qualität, im Guten wie im Schlechten. Die legendäre „Yes we can“-Kampagne, die Barack Obama 2009 ins Weiße Haus brachte, gilt als extrem gelungenes Beispiel für Personalisierung und den erstmaligen Einsatz von Social Media in großem Stil.
Wenn es um Wahlkämpfe geht, blicken wir von Deutschland aus oft mit einer Mischung aus Faszination und Abscheu in die USA. Dort – so scheint es – hat der politische Wettstreit eine ganz andere Qualität, im Guten wie im Schlechten. Die legendäre „Yes we can“-Kampagne, die Barack Obama 2009 ins Weiße Haus brachte, gilt als extrem gelungenes Beispiel für Personalisierung und den erstmaligen Einsatz von Social Media in großem Stil.
Umgekehrt kann das radikale Zuschneiden der Kampagne auf die Kandidatinnen und Kandidaten auch Auswüchse hervorbringen: wie die Kampagne von Donald Trump 2016, die Maßstäbe in Sachen Negative Campaigning setzte.
Kandidatinnen und Kandidaten im Vordergrund
Auch hierzulande wird in politischen Kampagnen immer stärker personalisiert: FDP-Chef Christian Lindner im Unterhemd, der Grüne Winfried Kretschmann bei Holzarbeiten in seiner Werkstatt, der glücklose SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz und sein Würselen. Die Parteien treten weiter in den Hintergrund.
Die Bindung zu Parteien und die Zugehörigkeit zu definierten gesellschaftlichen Milieus nimmt stetig ab, die Neigung zum Wechselwählen dagegen zu. Ergo werden politische Kampagnen immer radikaler auf die Kandidatinnen und Kandidaten zugeschnitten.
Wählerinnen und Wähler, die – vielleicht auch mit geballter Faust in der Tasche – stets ihr Kreuzchen bei „der CDU“ oder „der SPD“, machen, werden weniger. Die Überzeugungskraft muss aus den Kandidatinnen und Kandidaten heraus kommen, die – wenn es gut läuft – möglichst deckungsgleich mit der programmatischen Ausrichtung ihrer Partei sind.
Dabei ist das Thema Personalisierung in Wahlkämpfen an sich ein alter Hut. „Ich weiß gar nicht, wann Wahlkämpfe nicht personalisiert gewesen wären“, meint Frank Stauss von der Agentur Richel, Stauss. Er ist einer der erfahrensten und profiliertesten Wahlkampfberater und -manager der Republik.
 „Manchmal wird Personalisierung mit der Frage verwechselt, inwieweit Politikerinnen und Politiker jenseits von Politik in Erscheinung treten. Das war bei Lincoln nicht anders als bei Obama. In den USA wählt man sowieso direkt die Person und nicht die Partei. Bei uns ist die Person aber immer der entscheidende Transmissionsriemen zur Partei.“
„Manchmal wird Personalisierung mit der Frage verwechselt, inwieweit Politikerinnen und Politiker jenseits von Politik in Erscheinung treten. Das war bei Lincoln nicht anders als bei Obama. In den USA wählt man sowieso direkt die Person und nicht die Partei. Bei uns ist die Person aber immer der entscheidende Transmissionsriemen zur Partei.“
Will heißen, dass eine Wählerin oder ein Wähler ihre Entscheidung tatsächlich nach dem Parteiprogramm trifft, ist ein frommer Wunsch, der keine Verankerung in der Realität hat.
Die Wahlkampfstrategien haben sich verändert
Aber auch wenn es schon immer Personalisierung in Wahlkämpfen gab, so haben sich Quantität und Qualität bei Wahlkampfstrategien im Laufe der Zeit spürbar verändert.
Willy Brandt hat zum Beispiel das Private in großem Stil in den Wahlkampf eingebracht. „Das vergleichsweise junge Paar Ruth und Willi Brandt am Frühstückstisch inszeniert – das war natürlich auch ein Generationswechsel“, so Stauss.
Ein weiterer Wendepunkt hängt wieder mit einem SPD-Kanzler zusammen: Gerhard Schröders Wahlkampf 1998 gegen Helmut Kohl. Die Kampagne begann damals rund ein Jahr vor dem Wahltermin, noch bevor der Kandidat endgültig feststand. Es gab damals einen parteiinternen Wettstreit zwischen Gerhard Schröder, Oskar Lafontaine und Rudolf Scharping. Die SPD versuchte aus der Not eine Tugend zu machen und vermarktete das ungleiche Trio als „Troika“. Der Slogan der Kampagne lautete zunächst „Wir sind bereit“.
Kaum hatte Schröder das Rennen um die Kandidatur für sich entschieden, ließ er den Spruch ändern in „Ich bin bereit“. Der Wahlkampf wurde in der Folge komplett auf den Kandidaten zugeschnitten.
Ex-Kanzler im Sonnenlicht am Nordseestrand
Bekannt wurde in diesem Zusammenhang der so genannte „Jever Spot“ aus jener Kampagne. Der TV-Spot zeigte den SPD-Mann Schröder im Sonnenlicht am Nordseestrand. Der Name „Jever Spot“ kam wegen der augenfälligen Ähnlichkeit zu der bekannten Bierwerbung.
Verantwortlich für den Spot damals war die Agentur KNSK. Natürlich lebte die Inszenierung Schröders 1998 auch vom Gegensatz zum 16 Jahre amtierenden und erkennbar amtsmüden Helmut Kohl.
Bei der nächsten Wahl trat Schröder gegen Edmund Stoiber von der CSU an. Der Wahlkampf fiel in die Zeit der Oderflut. Schröder nutzte die Gelegenheit und trat vor Ort in überfluteten Gebieten in Gummistiefeln als Krisenmanager und Macher auf. Außerdem profilierte er sich mit seiner konsequenten Absage, am Irak-Krieg des damaligen US-Präsidenten George W. Bush teilzunehmen.
Sein Gegenspieler Stoiber versuchte unterdessen, gemeinsam mit seinem Berater, dem früheren Bild-am-Sonntag-Chefredakteur Michael Spreng, das Image des staubtrockenen „Aktenfressers“ loszuwerden. Hierzu wurde auch Stoibers Familie in den Wahlkampf eingespannt.
Ehegattin Karin Stoiber gab Interviews, die Tochter wurde als selbstbewusste, moderne Frau präsentiert. Wie die Zeitschrift „Aus Politik und Zeitgeschichte“ in einer Analyse des Wahlkampfes 2002 festhielt, verstieß der Einsatz von Karin Stoiber aber gegen eine alte Kampagnenregel, dass Images nicht unabhängig von der Persönlichkeit des Kandidaten konstruiert werden sollen.
Warum Plakate keine Wahlen entscheiden
Aus einem trockenen, kantigen Stoiber macht man eben in keiner Kampagne einen modernen, emotionalen Typen. Letztlich verlor Stoiber dann auch, wobei das nicht (nur) an der Art und Weise des Wahlkampfes gelegen haben dürfte.
Plakate und Kampagnen könnten keine Wahl entscheiden, meint Matthias Riegel, Vorstand bei der Berliner Agentur Wigwam. Die Agentur hat zahlreiche Wahlkämpfe für die Grünen betreut.
Kampagnen könnten bestenfalls eine Haltung für den Wahlkampf vorgeben, so der Agenturchef. Riegel und Wigwam waren auch verantwortlich für eine Kampagne, die Frank Stauss für ein „Paradebeispiel für die gelungene Inszenierung einer Person“ hält, nämlich den Wahlkampf 2016 zur Landtagswahl Baden-Württemberg für die Grünen. Sie war auf den beliebten Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann ausgerichtet. Der war 2011 als erster Grüner in das Amt eines Ministerpräsidenten gewählt worden – und das im CDU-Kernland Baden-Württemberg.
Damals gab es freilich ein paar besondere Faktoren: Zum einen stand die Welt unter dem Schock der Nuklearkatastrophe von Fukushima, was den Grünen allgemein einen gewissen Aufwind verlieh. Regional war der Streit um den Bahnhofsneubau Stuttgart 21 ein wichtiges Thema.
Zum anderen verfügte die CDU mit Stefan Mappus über einen wenig charismatischen Kandidaten, der sich zudem als Befürworter der Kernenergie positioniert hatte.
Der Grünen-Kandidat in der Holzwerkstatt
Bei Kretschmanns zweiter Kandidatur schuf Wigwam einen geradezu genialen Werbespot, der Kretschmann in seiner eigenen Werkstatt zu Hause bei Holzarbeiten zeigte. Motto: „Etwas schaffen, das bleibt.“
 Der Spot griff die Wahlwerbung der 2011er-Kampagne der Grünen auf, die den Kandidaten beim Baumschnitt in einem Garten präsentiert hatte. Nun konnte er im Amt bzw. in seiner Werkstatt gestalten. Der Spot endet, als Kretschmann aus der Werkstatt tritt und in die Dienstlimousine steigt. Der Bogen wird vom Privaten, von den persönlichen Werten hin zum Politischen, geschlagen.
Der Spot griff die Wahlwerbung der 2011er-Kampagne der Grünen auf, die den Kandidaten beim Baumschnitt in einem Garten präsentiert hatte. Nun konnte er im Amt bzw. in seiner Werkstatt gestalten. Der Spot endet, als Kretschmann aus der Werkstatt tritt und in die Dienstlimousine steigt. Der Bogen wird vom Privaten, von den persönlichen Werten hin zum Politischen, geschlagen.
Nicht umsonst wurde diese Kampagne 2016 als beste politische Kampagne mit dem Politikaward ausgezeichnet.
„Ich finde eine personalisierte Kampagne nur gut, wenn das wirklich authentisch ist“, sagt Riegel heute. „Ich hätte diesen Spot nicht gemacht, wenn wir nicht in seine eigene, echte Garage gedurft hätten zum Dreh. Ich bin kein Fan davon, jemandem eine Tüte aufzusetzen und irgendwas draufzumalen.“
Die Werkstatt sei letztlich nur eine Metapher gewesen: „Wir haben den Menschen Zeit gegeben, ihm zuzuhören, wie er Politik versteht. Wir wollten das Gefühl vermitteln, er packt selbst an. Will etwas schaffen, das bleibt.“ Die Darstellung war hier in bestem Sinne authentisch.
Bei Edmund Stoibers Kanzlerkandidatur hingegen wurde versucht, ein Image zu erschaffen, das nicht seiner wahren Natur entsprach.
Eine Inszenierung kann aber auch scheitern
Riegel hat danach auch für andere Grünen-Politikerinnen und -Politiker erfolgreiche Kampagnen gestaltet: 2017 in Schleswig-Holstein und vergangenes Jahr in Bayern mit der Spitzenkandidaten Katharina Schulze. Riegel: „Da ging es genau um die Stärke, das Engagement und den Willen zur Veränderung. Das muss man als Berater dann pushen, schärfen, begleiten.“
In diesem Jahr betreuen Wigwam und Riegel auch den Wahlkampf der Grünen in Sachsen. Kein einfacher Job, auch wenn die Partei bundesweit einen überaus positiven Trend in den Umfragen verzeichnen kann.
Katja Meier und Wolfram Günther sind das Spitzenduo der Grünen in Sachsen. Klar ist bislang nur, dass es nicht einfach werden wird: „Man muss es schon mögen, dieses Wahlkampfding“, sagt Riegel.
Das Inszenieren von Politikerinnen und Politikern in Wahlkämpfen kann aber natürlich auch in die Hose gehen. Ein Negativ-Beispiel ist die Kandidatur des SPD-Manns Torsten Albig, der 2017 in Schleswig-Holstein gerne wieder Ministerpräsident geworden wäre.
In der People-Zeitschrift Bunte ließ er sich im Wahlkampf gemeinsam mit seiner neuen Lebensgefährtin interviewen. Dabei sagte er verhängnisvolle Sätze über seine langjährige Ehefrau, von der er sich frisch getrennt hatte: „Irgendwann entwickelte sich mein Leben schneller als ihres.“ Er habe sich mit der Gattin kaum noch „auf Augenhöhe“ ausgetauscht. Und: „Ich war beruflich ständig unterwegs, meine Frau war in der Rolle als Mutter und Managerin unseres Haushaltes gefangen.“
Was wohl menschlich und offen wirken sollte, kam arrogant und unsympathisch rüber. Dass Albig und die SPD die Wahl nur wegen des Interviews verloren, darf bezweifelt werden – geholfen hat es aber sicher nicht.
Vorsicht bei Privatem: Lieber nicht zu viel
Das Private im Politischen kann tückisch sein. Erinnert sei auch daran, als Horst Seehofer einst als bayerischer Ministerpräsident mit dem heimischen Familienglück auf Plakaten warb: Das fiel ihm auf die Füße, als eine außereheliche Beziehung publik wurde.
Oder der SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz, für den sich die Positionierung als bodenständiger Ex-Bürgermeister aus dem nordrhein-westfälischen Würselen nicht eben als hilfreich erwies.
In Zeiten von Social Media gilt ohnehin: Vorsicht mit dem Privaten. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder empfing die Bunte zur „Home“-Story im Wahlkampf in seinem Büro statt in den eigenen vier Wänden. Lieber nicht zu viel preisgeben.
Wahlkampfmanager Stauss kennt das: „Heute werden Kinder und das ganze familiäre Umfeld eher beschützt. Bei der Vorbereitung von Kampagnen werde ich mittlerweile viel öfter mit der Frage konfrontiert: Wie halte ich meine Familie da raus? Oder: Was ist das Minimum an Privatem, das man machen muss?“
Merkel: Die inszenierte Nicht-Inszenierung
Und was ist mit Angela Merkel? Ist sie nicht das lebende Beispiel dafür, dass es gar keine Personalisierung und Inszenierung braucht, um politisch über viele Jahre hinweg erfolgreich zu sein? Nicht ganz.
Auch bei Angela Merkel waren die Kampagnen sehr stark auf sie als Person zugeschnitten. Stauss bezeichnet ihren Wahlkampf-Stil als „gelungene Unter-Inszenierung“, was ihre Gegnerinnen und Gegner bisweilen zur Verzweiflung treiben konnte.
Ihren Stil der inszenierten Nicht-Inszenierung führt sie im TV-Duell mit SPD-Kandidat Peer Steinbrück 2013 zur Meisterschaft, als sie dem Publikum den Satz mit auf den Weg gab: „Sie kennen mich!“ Eine moderne Variante des CDU-Klassikers aus der Adenauer-Zeit: „Keine Experimente!“
Angela Merkel gilt zudem als Kanzlerin, die so extrem auf ihre Bild-Hoheit achtet wie niemand zuvor in diesem Amt. Das Kanzleramt und ihre Sprecher kontrollieren streng, was in welcher Form „nach draußen“ geht.
Personalisierung in der Politik kommt also – der Name sagt es schon – stets auf die Person an. Einen bestimmten Personentypus, der sich besser oder schlechter für eine Kampagne eignen würde, gibt es nicht. Da sind sich beide Wahlkampfberater einig. Wollen Kampagnen erfolgreich sein, müssen sie zum Wesenskern der Politikerinnen und Politiker vordringen. Sie dürfen nicht versuchen, eine Person öffentlich anders darzustellen, als sie wirklich ist – das geht meistens schief. Eigentlich eine ganz gute Botschaft, oder?
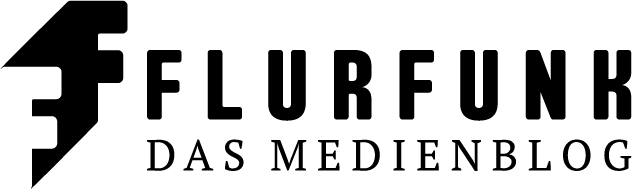
Kommentar hinterlassen